Als Partner rund um den Produkte-, Anwender- und Umgebungsschutz stehen bei Skan unter anderem Laborabzüge im Fokus von Weiterentwicklungen. Beim Service, entlang des gesamten Produktlebenszyklus, kann das Unternehmen auf reichhaltige Erfahrungen zurückgreifen und bietet innovative Testverfahren für die Robustheit und Ausbruchssicherheit von Sicherheitsarbeitsplätzen.
In der Schweiz sind rund 36 000 Laborabzüge installiert. Viele davon stehen tagtäglich im Einsatz und sorgen für die Sicherheit der Mitarbeitenden im Labor. Skan’s Erfahrungen zufolge, zeigen jedoch zirka 20 Prozent davon mehr oder weniger schleichenden chemischen Ausbruch, das heisst: Es können Substanzen über die Arbeitsöffnung aus dem Abzug in die Laborumgebung gelangen. Oft handelt es sich um potenziell gefährliche Chemikalien, die entweichen. Dadurch werden fehlerhafte Abzüge von einem zentralen Schutzelement im Labor zur möglichen Quelle von Gesundheitsgefahren. Tausende Schweizer Mitarbeitende könnten somit regelmässig chemischen Substanzen exponiert sein. Die Gefahr lässt sich, je nach Substanz, manchmal sehen (Rauchentwicklung) oder riechen (z. B. Lösungsmittelgeruch). Darum gibt es in anderen Ländern bildliche Namen: Ein Laborabzug heisst im Englischen «Fume Cupboard» (Rauch-Schrank) und im Dänischen «Stinkskab» (Gestanks-Schrank).
Belüftungseffizienz mit Überraschungen
Laborabzüge hängen über die Belüftung direkt mit der Laborumgebung zusammen. Schon «normale» Laborluft wird als potenziell gefährlich angesehen, da mit einer erhöhten Konzentration an mehr oder weniger flüchtigen Chemikalien und luftgetragenen Schadstoffen gerechnet werden muss. Damit verbundene Risiken akkumulieren sich für den Mitarbeitenden über ein ganzes Berufsleben. Wieviel Luftaustausch braucht es für frische Luft im Labor mit ausreichend Sicherheit? Dafür hat die neue Schweizer Laborrichtlinie EKAS 1871:2022 eine Mindest-Luftwechselrate für alle Labore von drei Mal pro Stunde definiert. Für gefährlichere Substanzen schlägt sie im Anhang 5 weitere vier Labor-Belüftungsniveaus vor: Je nach Stoffklasse und Giftigkeit der Substanzen steigt die Zahl bis zum 20-fachen Luftwechsel.
Solche Luftwechselzahlen werden meistens nur theoretisch berechnet. Man setzt dafür den Zuluftvolumenstrom zum Labor-Raumvolumen ins Verhältnis, oder bei Laborabzügen einfach den Abluftvolumenstrom zum Innenvolumen. Stillschweigend wird eine gute und homogene Durchmischung der Laborluft vorausgesetzt. Skan setzt aktuell neue Messverfahren ein, mit denen man tatsächliche Austauschraten im Labor ortsgenau bestimmen kann. Dieser Belüftungs-Effizienztest zeichnet in einer halben Stunde Luftwechsel an 10 bis 20 Positionen unabhängig voneinander auf. Die Ergebnisse sorgen regelmässig für Überraschungen, denn nicht jeder Laborraum weist automatisch eine ideale Luftdurchmischung auf. So kann in einem Laborraum die Luftwechselzahl, theoretisch gesehen, in Ordnung sein – in der realen Situation «steht» die Luft aber in toten Winkeln länger, wo sich dann potenziell gesundheitsgefährdende Substanzen länger im Raum halten können.
Abzüge mit mehreren Funktionen
Wenn schon «normale» Laborluft die Gesundheit beeinträchtigen kann, so wird hoffentlich das Personal Tätigkeiten mit gefährlichen Substanzen im Containment (z. B. Laborabzug) durchführen. Die Laborluft strömt von vorn, durch die Arbeitsöffnung, in den Abzug ein und nimmt dabei luftgetragene Schadstoffe auf. Je nach Design bildet sich im Inneren mit einem Teil der Luft eine charakteristische horizontale Luftwalze. Der andere Teil der Luft wird im Bereich der Rückwand und im oberen Abschnitt abgezogen. Abgezogen heisst herausgeführt aus dem Labor, über die Hausabluft nach draussen befördert und somit in die Umwelt abgegeben. So schützt der Abzug die Mitarbeitenden vor Chemikaliendämpfen und Rauch, bei geschlossener Frontscheibe zusätzlich vor Feuer, Ex- und Implosionen, Spritzern und Glassplittern. Wichtig ist, dass ein ausreichender Luftvolumenstrom durchgesaugt wird. Dabei kann man durchaus auch übers Ziel hinausschiessen: Es gibt in der Praxis Abzüge mit viel zu hohem Luftdurchsatz. Wenn dort deren «Lüftungsleistung» etwas herabgesetzt wird, kann bei angemessener Schutzfunktion wertvolle Energie und konditionierte Laborluft eingespart werden.
Angesichts der komplexen Thematik empfiehlt es sich, Abzüge regelmässig, z. B. jährlich, überprüfen zu lassen. Arbeiten Sie noch «robust», das heisst ausreichend resistent gegen störende Luftströmungen aus der Laborumgebung? Sind Arbeitsschutz, Explosionsschutz und energieeffizienter Betrieb gleichermassen gesichert?
Falls diese Prüfung negativ ausfällt, ist in den wenigsten Fällen der Abzugshersteller verantwortlich – insbesondere dann, wenn der Hersteller für sein Produkt die Typenprüfung nach Norm SN EN 14175-3 mit einem Zertifikat nachweisen kann. Vielmehr führen folgende Faktoren in der Umgebung zu fehlerhaften Abzügen:
• Deckenauslässe mit Luftströmung blasen direkt in die Arbeitsöffnung
• Geräte und Computer mit Kühlventilator im Laborabzug, die Luft herausblasen und Luftführung stören
• Personaldurchgänge führen Menschen zu dicht am Laborabzug vorbei
• Laborabzüge sind zu nahe bei schwenkenden Türen (auch bei Abzugsbrand ist eine nahe Position zu Fluchttüren ungünstig)
• Die Klimaanlage (Kühlungsmodul) hängt an der Decke, springt sporadisch an und bläst direkt in den Laborabzug
• Zuviel Installationen oder Behälter im Laborabzug (etwa 80 Prozent der Laborabzüge sind voller Gegenstände oder haben feste Zusatzeinbauten)
• Laborabzüge werden vom Anwender mit Eigenbau abgeändert (seitliche Öffnungen, eingebaute Regale, Zusatztische usw.)
• Der Laborabzug wird wegen Limiten der Gebäudetechnik mit zu wenig Luft betrieben
Ein neuer Test für Abzüge
In der Schweizer EKAS-Laborrichtlinie 1871:2022 wird ein Robustheitstest vor Ort am installierten Laborabzug beschrieben. Darin ist u.a. ein neuer Grenzwert für das Test-Tracergas Schwefelhexafluorid (SF6) angegeben, mit ≤ 0,65 ppm Ausbruch. Dieses Gas bietet eigentlich gute physikalische Eigenschaften für solche Tests. In der Vergangenheit, ab ca. 1970, wurden Luftanlagen in Gebäuden, U-Bahnen und Strassen-Tunnels mit Schwefelhexafluorid geprüft. So war es nicht verwunderlich, dass 1995 damit auch ein Standard-Testverfahren als Robustheitstest für Laborabzüge (SN EN 14175-4:2005) definiert wurde. Bei Neuinstallation eines Laborabzugs kann dessen Robustheit damit getestet und ein Startwert ermittelt werden. Später, beim jährlichen Routineservice, kann dann auf Beibehaltung dieses Initialwerts geprüft werden.
Basierend auf der EU-Richtlinie 2024/573 und gemäss nationalen Nachhaltigkeitsprogrammen soll das klimaschädliche Schwefelhexafluorid künftig aber unbedingt vermieden werden. Im Sinne des Schweizer Klimaschutzes hat Skan deswegen einen Alternativ-Test für Laborabzüge entwickelt (siehe Abb. 1).
Dabei wird statt dem SF6-Gas ein Isopropanol-Gas (IPA) verwendet. IPA ist ein flüssiger, umweltschonender Alkohol, bekannt aus der Händedesinfektion. Das Forschungsteam hat diesen neuartigen Containmenttest («SKAN conttest») mit dem alten normativen SF6-Verfahren abgestimmt und 2022 die Validierung in einem unabhängigen Prüflabor erfolgreich durchgeführt. Damit sind die neu gemessenen Isopropanol-Testwerte mit früher ermittelten SF6-Testwerten, für die nötige Kontinuität der Testergebnisse, direkt verglichen worden.
Leistungsfähigkeit des neuen Tests
Mit dem neuen Containment-Test lässt sich (herstellerunabhängig) fast jeder Laborabzug auf seine Ausbruchssicherheit testen. Da es sich um einen Massentest handelt, wurde eine wichtige Herausforderung gemeistert: Die reine Messdauer, ohne Aufbau, beträgt nur 10 Minuten. Es lässt sich in dieser Zeit die Ausbruchssicherheit eines Abzugs nachweisen und in vergleichbaren Zahlen und Daten darstellen. Auf der Basis von 9000 Einzeldaten wird jeder gemessene Abzug einer «Containment Performance Class» von 0 bis 3 zugeordnet.
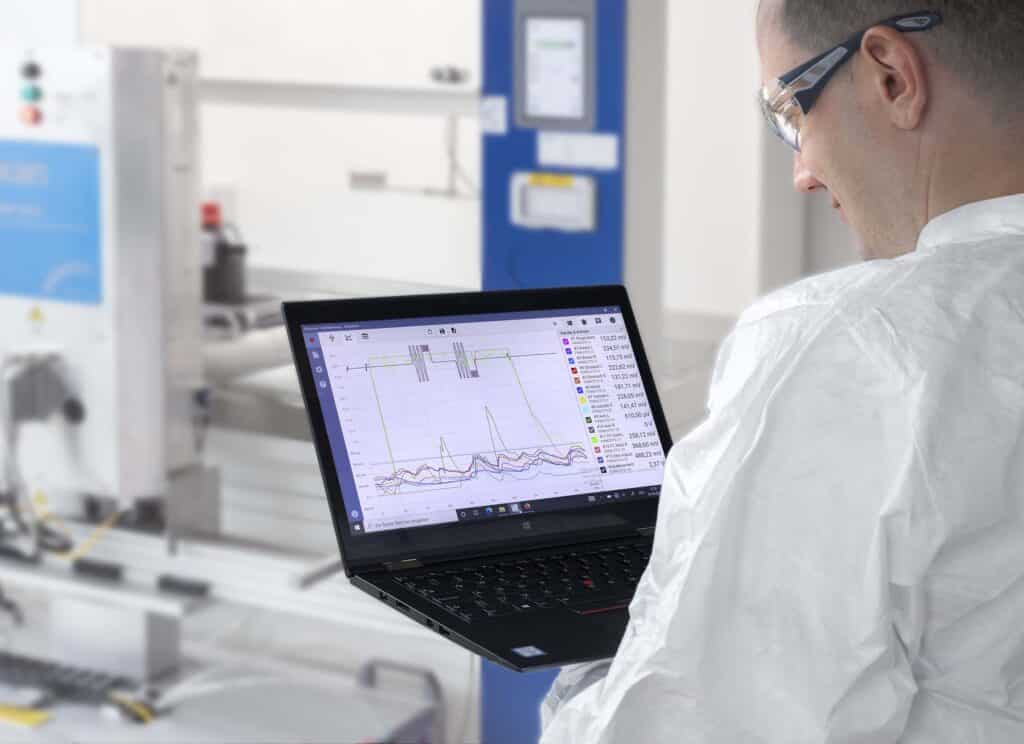
Einbauten und sperrige Gefässe müssen während der Messung nicht aus dem Laborabzug genommen werden, ausser er ist wirklich überfüllt. So wird die Messung äusserst realitätsnah, zusätzlich werden mit einem Roboter-Prüfkörper vor der Abzugsöffnung Bewegungen eines Operators simuliert. Möchte man genauere Informationen oder passt man die Abzugsparameter nach dem Test an, kann die Messung gleich wiederholt werden. Der Skan-Abzugs-Service konnte so inzwischen über 1000 Laborabzüge in der ganzen Schweiz testen und zusätzlich einige grössere Stehabzüge nach ähnlichem Prinzip überprüfen.
Containment lässt sich damit testen, wie steht es aber mit dem Explosionsschutz? In unbeaufsichtigten und geschlossenen Abzügen (z. B. Über-Nacht-Betrieb) sollen sich keine explosiven Gasgemische ansammeln. Das erreicht man am einfachsten mit einer Verdünnung im Innenraum, durch ausreichend Zuluft aus dem Raum. Die nötige Mindestluftmenge dafür wurde neu in der aktuellen Schweizer Laborrichtlinie EKAS 1871 festgelegt. Im unteren Bereich des Arbeitsraums (bis 10 cm über Arbeitsfläche) soll mindestens 50 % der Lüftungsleistung bereitgestellt werden. Prinzipiell eine gute Forderung, für die ein europaweites Testverfahren jedoch noch nicht richtig standardisiert ist. Besonders für alte Bestandsanlagen wäre es aber wertvoll, zu testen, ob in dem betreffenden Bereich ausreichend belüftet wird. Im Sinne der Labormitarbeitenden testet Skan aktuell eine Standard-Testvariante und will diese für die Schweiz als Standard vorschlagen.
Wie beschrieben, wird gewärmte oder gekühlte Laborluft über die Abzüge unter Energieaufwand aus dem Gebäude direkt in die Aussenluft abgezogen. Häufig erweisen sich Abzüge deswegen als die grössten Energieverbraucher im Gebäude und fressen bis zu 50 % der Labor-Gebäudeenergie. Daher sollte man speziell deren Abluftmengen regelmässig kontrollieren. In einem Gebäude kann sich über die Zeit lufttechnisch viel verändern. Es lohnt sich, die Abzüge auf korrekte Abluftmengen und somit Einsparmöglichkeiten zu prüfen.
Ist die Abluftmenge zu gering eingestellt, ist der Labormitarbeitende am Abzug in Gefahr. Ist sie zu hoch, geht viel Energie weg in die Hausabluft. Bei Verdacht auf zu hohe Luftvolumenströme lässt sich mit Containment-Tests nachweisen, dass vielleicht etwas niedrigere Luftmengen (stets mit Reserven) einen ausbruchssicheren und «robusten» Betrieb erlauben könnten. Für einen Einzel-Laborabzug mag das nicht arg ins Gewicht fallen. Bei 20 Laborabzügen mit 500 m3/h statt 700 m3/h multipliziert sich eine mögliche Einsparung jedoch schnell zu sage und schreibe 4 000 m3/h. Je nach Betriebsart ergeben sich so übers Jahr Einsparungen von mehr als 7 Millionen Kubikmetern an konditionierter Luft.
Fazit: Abzugs-Service lohnt sich mehrfach
Es bleibt festzuhalten: Jährlich werden in der Schweiz zwischen 500 und 1000 Abzüge ausgetauscht oder neu installiert. Etwa 36 000 werden insgesamt betrieben, auf Containment werden jedoch noch viel zu wenige getestet. Beim Initialtest und bei der Routine-Überwachung gibt es dafür Dienstleistungen, die sich für die Sicherheit der Laboranten, den Labor-Energieverbrauch und für die Umwelt zugleich lohnen.
Skan AG
CH-4123 Allschwil
vk-lab@skan.ch
https://skan.com




